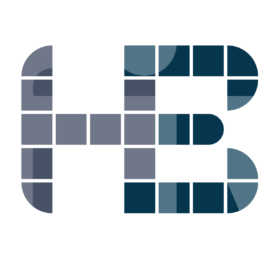Das inzwischen vierte Berliner Erstligaderby verspricht wieder eine heiße Partie zu werden. Die beteiligten Mannschaften werden gerne als totale Gegensätze dargestellt. Dieser Text klärt die Frage, ob Union auch ohne Hertha funktioniert, welchen Herausforderungen sich die Köpenicker in der Zukunft gegenüber sehen und was die beiden Klubs beim gemeinsamen Kaffee-Date bestellen.
Union definiert sich darüber, was man nicht ist
Bestellt man in einer Berliner Kneipe ein „Herrengedeck“, kann es mitunter vorkommen, dass man nicht Bier und Schnaps, sondern Bier und Sekt gereicht bekommt. Die Logik dahinter: Bier für den Mann und der Sekt für seine weibliche Begleitung.
Bestellt man stattdessen ein Berliner Fußballderby, dann bekommt man im Grunde das Gleiche, inklusive der antiquierten Geschlechterrollen. Dennoch sind die Rollen beim kommenden Derby klar zugewiesen. Auf der einen Seite die bodenständigen Köpenicker, stellvertretenden für den authentischen Arbeiter, mit dem man gerne mal ein Bier trinken gehen und sich über die Gesamtsituation auskotzen würde. Ihm gegenüber die mondäne „Alte Dame“, die beherzt das Geld ihres reichen Gönners ausgibt und nach dem dritten Glas Sekt ein bisschen zu laut und zu prahlerisch von ihren Bekanntschaften erzählt.

Beide Vereine, ihre Fans und die Medien haben jeweils mehr oder weniger zu diesem Bild beigetragen, es kultiviert oder auch versucht zu übermalen. Die Koketterie mit dieser augenscheinlichen Gegensatz ist nicht zu übersehen und auch wenn Union sich betont desinteressiert gibt, hat das Ganze dann doch eher den Anschein, als würde man versuchen sich weniger darüber zu definieren, was man ist, sondern, was man nicht ist, nämlich nicht Hertha.
Hertha und Union: Was wollen die Klubs?
Während Union allerdings noch vollends im modernen Event-Fußball, mitsamt seiner Dynamik, ankommen muss, steckt Hertha, siehe Windhorst, schon längst drin. Das bedeutet aber auch, dass Union sich einer wichtigen Frage stellen muss: Wen wollen sie eigentlich als Fans haben? Hertha hat diese Frage schon längst für sich beantwortet. Der Anspruch ist hier ganz Berlin mitzunehmen, also sowohl den ehrlichen Malocher aus Reinickendorf als auch die neureichen Yuppies aus Charlottenburg. Das der Verein hier manchmal übers Ziel hinaus schießt und die Zusammensetzung seiner Fanbasis anders bewertet, als sie eigentlich ist, steht dem Ursprungsgedanken nicht im Weg: Hertha will DER Berliner Klub sein.
Unions Lokalpatriotismus richtet sich zunächst erstmal auf den eigenen Bezirk, im nächsten Schritt auf den Ost-Teil der Stadt. Das ist marketingtechnisch sehr charmant, blendet die Realität aber gewieft aus. Union ist natürlich nicht mehr nur der Köpenicker Club, sondern genauso ein Unternehmen, wie Hertha und als eben dieses daran interessiert gut zu wirtschaften und auch mehr als die 280.000 Einwohner:innen von Treptow-Köpenick anzusprechen.

Während Union hier zurecht stolz auf das das Engagement der Fans in puncto Stadion und „Bluten für Union“ verweisen kann, stehen bei Hertha der Streit mit dem Senat über ein neues Stadion, ein Millionen-Investment und zweifelhafter sportlicher Erfolg zu buche. Der einzige Lichtblick scheint das außerordentliche Engagement von Herthas-Fanszene zu sein. Das wird von denen, die die Unterschiede zwischen den Clubs herauszustellen suchen, oft gerne bewusst vergessen. Dreht man die Uhr noch weiter zurück, erzählt Union gerne die Geschichte des Anti-Stasi-Clubs, während Hertha sich in den 70ern tief im Bundesliga-Skandal verwickelt sah.
Der Arbeiter als Marketingobjekt
Es sieht also nicht gut aus für die alte Dame. Die Öffentlichkeit hat sich festgelegt: Union steht für das, was Fußball einst war und Hertha für das, was er nie werden sollte. Doch so einfach ist es nicht. Denn es ist eben dieses „Anders-Sein“, was Union die Fans einbringt, die mit dem ursprünglichen Gedanken wenig bis nichts zu tun haben. Was wir in Köpenick beobachten dürfen, ist ein gewisser positiver Klassismus-Sport-Tourismus. „Komm wir gehen mal zu Union, da sind Wurst und Bier noch zu bezahlen und von den Tribünen wird auch mal ein „Scheiße“ gerufen“. Versteht mich nicht falsch, ich zitiere hier nicht den langjährigen Unioner, sondern diejenigen, die jetzt, nachdem Union es in die erste Liga geschafft hat, ihre plötzliche Liebe zum Fußball entdecken. Das spiegelt sich auch in den Mitgliederzahlen wider. Hatte Union 2006, noch in der Oberliga spielend, 4200 Mitglieder, sind es 2021 und viele wichtige sportliche Erfolge später, knapp 38.000. Man könnte hier den Begriff „Erfolgsfans“ einwerfen und sich an den Reaktionen erfreuen, doch zurück zur Sachlichkeit.
Das Problem ist, dass der Fußball schon längst ein Lifestyle-Produkt geworden ist. Sicherlich gibt es Überbleibsel, die von seinen proletarischen Wurzeln zeugen, aber sowohl Boxing Day als auch „Werkself“ sind heute eigentlich nur noch Marketingfloskeln geworden. Mit diesem Umstand muss sich auch Union auseinandersetzen. Sollen sie ihre Kultigkeit und Authentizität weiter betonen und damit Gefahr laufen, die Menschen anzuziehen, die sich am Arbeitertum zu ergötzen suchen, bevor sie in ihre Eigentumswohnung in Prenzlauer Berg zurückkehren oder sollen sie heimlich still und leise den Mahlsteinen der Kommerzialisierung hingeben?

Natürlich muss sich auch Hertha mit diesem Konflikt befassen, dadurch, dass ihre Fan-Strategie jedoch bewusst nicht klientelpolitisch aufgeladen wird, haben sie es zumindest ein wenig einfacher. Hertha und Union ist die spannendste Berliner Sport-Rivalität, die es momentan zu erleben gibt. Natürlich gibt es Animositäten zwischen dem BFC und Union, sportlich ist die Bundesliga jedoch nun mal am interessantesten. Union scheint sich hier als „Anti-Hertha“ durchaus zu gefallen. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Doch das funktioniert eben nur solange es Hertha in dieser Form gibt.
Sich gegen Hertha zu stellen, klappt nur, solange Hertha eben auch einen kritikwürdigen Kurs fährt. Windhorst macht es hier jeder Fußballromantiker:in allerdings auch sehr einfach. Die Kritik hier nimmt manchmal auch zynische Züge an, wie wenn, das schon erwähnte, soziale Engagement der Hertha-Fans als Marketingaktion verkannt wird. Was bleibt, ist allerdings, dass die eigene Position umso stärker wird, desto stärker der Kontrast zwischen den beiden Vereinen wahrgenommen wird.
Kaffee und Fußball
Teil des Pakets „Union“ ist eben nicht nur, das was Union ist, sondern auch das, was es eben nicht ist und das was es nicht ist, wird hier stark in den Fokus gerückt. Um solche Beziehungen der Negation zu verdeutlichen greift der slowenische Philosoph Slavoj Žižek gerne auf einen Witz aus dem Film „Ninotschka“ vom großen Berliner Ernst Lubitsch zurück : „Ein Mann bestellt in einem Restaurant einen Kaffee ohne Sahne. Der Kellner kommt nach fünf Minuten zurück und sagt: „Tut mir leid, mein Herr, aber wir haben keine Sahne mehr, kann es auch ohne Milch sein?“ Obwohl das faktische Ergebnis in beiden Fällen das Gleiche ist, spielt das, was im Kaffee nicht drin ist eine ontologische Rolle. In anderen Worten: In beiden Fällen bekommt man einen Berliner Fußball Klub (schwarzer Kaffee), doch einmal ist dieser bewusst nicht Hertha (ohne Milch) und im anderen Fall nicht Union (ohne Sahne). Beides kann seinen Status jedoch nur behaupten, solange es eine Alternative gibt.

Vor diesem Hintergrund schickt sich vielleicht eine andere Anekdote an. Tommi Schmitt, seines Zeichens, Gladbach-Fan, Co-Host von „Gemischtes Hack“ und Union-Sympathisant: „Union ist ein schöner bunter Fleck in dieser Liga. [..] Eigentlich genau das, was Hertha immer sein wollte.“ Er erzählte jüngst in einer Folge „Gemischtes Hack“, wie er versuchte in einem hippen Berlin-Mitte Café einen Kaffee mit Milch zu bekommen. Der klischeehaft stark tätowierte, Man Bun tragende Barista verwehrte ihm diesen Wunsch jedoch unter dem Verweis auf das Konzept des Cafés. Man schenke einfach keinen Kaffee mit Milch aus, das würde die Aromen kaputt machen.
Was das im Bezug auf das Derby und den vermeintlichen Clash zwischen „echt“ und „fake“ heißt, kann sich jeder selbst zusammenreimen.
[Titelbild: IMAGO]